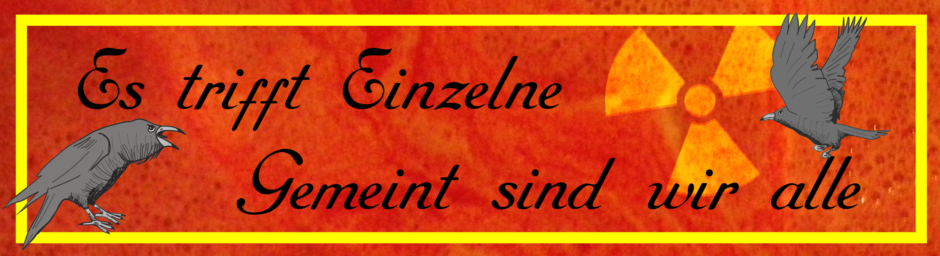Wir dokumentieren an dieser Stelle die Einlassung der Angeklagten im Berufungsverfahren wegen der Kletteraktion auf dem Dach der Brennelementefabrik vor dem Landgericht Osnabrück am 17.11.2025:
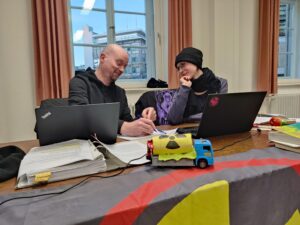 1957 verfasste Marie Luise Kaschnitz ihr Gedicht Hiroshima:
1957 verfasste Marie Luise Kaschnitz ihr Gedicht Hiroshima:
Der den Tod auf Hiroshima warf
Ging ins Kloster, läutet dort die Glocken.
Der den Tod auf Hiroshima warf
Sprang vom Stuhl in die Schlinge, erwürgte sich.
Der den Tod auf Hiroshima warf
Fiel in Wahnsinn, wehrt Gespenster ab
Hunderttausend, die ihn angehen nächtlich,
Auferstandene aus Staub für ihn.
Nichts von alledem ist wahr.
Erst vor kurzem sah ich ihn
Im Garten seines Hauses vor der Stadt.
Die Hecken waren noch jung und die Rosenbüsche zierlich.
Das wächst nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte
Im Wald des Vergessens. Gut zu sehen war
Das nackte Vorstadthaus, die junge Frau
Die neben ihm stand im Blumenkleid
Das kleine Mädchen an ihrer Hand
Der Knabe, der auf seinem Rücken saß
Und über seinem Kopf die Peitsche schwang.
Sehr gut erkennbar war er selbst
Vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht
Verzerrt von Lachen, weil der Photograph
Hinter der Hecke stand, das Auge der Welt.
Die Ignoranz gegenüber den mörderischen Einsatzzwecken der Atomenergie kann kaum besser in Worte gefasst werden. Wenn die Zeit damals auch eine andere war, so war das atomare Zerstörungspotential bereits bekannt, die Unbeherrschbarkeit und die Langzeitfolgen radioaktiver Strahlung wurden sichtbar.
Wenn wir in der Geschichte etwas weiter voran gehen, heißt es in dem Artikel „Eine kurze Geschichte der deutschen Anti-Atomkraft-Bewegung“ zu dem Atomkraftwerk in Wyhl:
Am 18. Februar 1975 besetzten mehre hundert Mitglieder einer seit 1972 bestehenden Bürgerinitiative (Oberrheinisches Aktionskomitee gegen Umweltgefährdung durch Kernkraftwerke) den Bauplatz des geplanten Kernkraftwerks Wyhl: Damit wurde erstmals die Schwelle zur illegalen Aktion überschritten; und in diesem Fall führte der Widerstand am Ende zum Erfolg.
… Vor allem als zwei Tage nach der Besetzung 650 Polizisten mit Wasserwerfern den Bauplatz stürmten, obwohl sich die Besetzer gewaltlos verhielten, rückte der Protest in die Hauptschlagzeilen, und allenthalben wogte den Widerständlern eine Welle spontaner Sympathie entgegen. Am 23. Februar strömten am gleichen Ort an die 28000 Atomkraftgegner zusammen, teilweise aus Frankreich und aus der Schweiz, besetzten das Baugelände nach einem Handgemenge mit der Polizei erneut und gründeten dort das erste deutsche Anti-AKW-Camp. Sie erzielten einen prompten Teilerfolg: Am 21. März 1975 hob das Verwaltungsgericht Freiburg die Teilerrichtungsgenehmigung auf und bewirkte einen vorläufigen Baustopp. … Das war ein mutiger Vorstoß der Freiburger Richter, dem andere Amtskollegen vorerst nicht folgten. Da der Berstschutz [eine Ummantelung für einen Störfall, wenn alle andern Sicherheitsvorkehrungen versagten] die Anlage ganz erheblich verteuert hätte, verlor das Energieunternehmen das Interesse an dem Projekt.“
Über diese Besetzung und die Konsequenzen für die Anti-Atom-Bewegung wurde ebenfalls analysiert:
„Diese Aktion war der Startschuss für eine der größten und gesellschaftlich wirkungsmächtigsten Bewegungen im Nachkriegsdeutschland. Und sie bezog ihre Schubkraft auch daraus, dass sie mit einem Erfolg startete: Wyhl wurde nicht gebaut, die Landesregierung knickte vor der Bewegung ein. Das war sozusagen die Initialzündung für die nachfolgenden erbitterten, von Seiten der Staatsmacht mit beispielloser Härte geführten Kämpfe um Atomkraftwerke überall – zu nennen sind hier vor allem Brokdorf, Grohnde und der Schnelle Brüter im niederrheinischen Kalkar.“
In den Siebziger Jahren gab es also bereits breiten Protest mit kreativen Formen des Widerstandes – und bereits damals wurde der Protest kriminalisiert.
Ein weiteres Beispiel ebenfalls aus dem Siebzigern zu einem Atomenergie-Projekt:
1979 zog der Gorleben-Treck mit 500 Traktoren aus dem Wendland in die Landeshauptstadt Hannover, wo sich am 31. März 1979 über 100.000 Menschen zur größten Demonstration in der Geschichte Niedersachsens [5] zusammenfanden. Einige Wochen nach der Demonstration sagte der damalige Ministerpräsident Ernst Albrecht, dass die Wiederaufbereitungsanlage zu dem Zeitpunkt politisch nicht durchsetzbar sei.[5] Die Planungen sind daraufhin eingestellt worden.
Gleichzeitig gab es scheinbar vereinzelt weniger irrlichternde Institutionen, die bereits damals die Absurdität der Atom-Industrie erkannten. In der Geschichte der weltweiten Anti-Atomkraft-Bewegung heißt es zum Erfolg in Wackersdorf:
„Ab 1985 begann bereits die bundesweite Mobilisierungsphase der Anti-AKW-Bewegung gegen die Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) in Wackersdorf in Süddeutschland. In diese Phase explodierte 1986 das AKW im ukrainischen Tschernobyl. Der Supergau war da. Die Anti-AKW-Bewegung in der BRD reagierte darauf schneller als alle Behörden und staatlichen Stellen, die abwiegelten und sich als völlig überfordert erwiesen. Der Tschernobyl-Schock saß tief, nie gab es so viele Demonstrationen und Aktionen gegen Atomanlagen. Selbst die SPD beschloss auf ihrem Nürnberger Parteitag den Ausstieg aus der Atomenergie innerhalb von zehn Jahren. Seit dieser Zeit gibt es in der BRD stabile Umfragewerte gegen die Atomenergie in der Bevölkerung.
Damit wurde nun auch den ignorantesten damaligen Zeitgenoss*innen die eklatante Gefahr in der sogenannten zivilen Atomnutzung offensichtlich, es bestand ein riesiger Protest in breiten Teilen der Bevölkerung und auch das bürgerliche Parteienfeld begann, die Absurdität aufflackern zu sehen – und einmal angemessen zu handeln (auch, wenn diese idealistischen Ideen eines Atomausstiegs in 1995 scheinbar zwischendurch abhanden kamen).
Dass von dem Betrieb von Atomanlagen und Atomkraftwerken eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben ausgeht, sollte selbstverständlich sein,
Heute, fast 70 Jahre nachdem Marie Luise Kaschnitz das Gedicht verfasste, sind wir immer noch der Meinung, Atomenergie wäre eine gute Lösung zur Energieversorgung, glauben, dass es eine Trennung zwischen militärischer und sogenannter ziviler Nutzung der Atomenergie gäbe und hoffen, eine sichere Lagerstätte für unsere radioaktiven Abfälle für die nächsten Jahrmillionen finden zu können. Glauben, Hoffen und Wünschen sollten allerdings besser in dem mythischen Kontext der Religion verbleiben, statt eine Grundlage für unsere Energieversorgung zu sein oder als Ausrede zur Zerstörung der Umwelt herzuhalten.
Denn schauen wir uns die Fakten an:
- Eine so genannte zivile Atomenergie könnte ohne eine militärische Nutzung wirtschaftlich nicht bestehen, hätte nie Fördergelder zu Forschungszwecken erhalten – und gleichzeitig produziert die Wiederaufbereitung von Brennstäben für Atomkraftwerke gleich das spaltbare Ausgangsmaterial für radioaktive Waffen mit. Welch traumhafte Win-win-Situation.
- Was wir zur Energieversorgung benötigen – neben einem radikal geringeren Verbrauch – ist eine unabhängige, flexible, dezentrale und möglichst Klima-schonende Bereitstellung von Energie. Atomenergie mit der Abhängigkeit von giftigem Uranbrennstoff, einem unflexiblen und nur begingt beherrschbaren, in jedem Fall aber gefährlichen Betrieb sowie einer ungeklärten Endlagerung der weiterhin strahlenden, gefährlichen Abfälle stellt das genaue Gegenteil dar. Es hat daher schon immer nur eine Lösung gegeben und es macht wütend, dass diese nach wie vor wiederholt werden muss: Raus aus jeglicher atomaren Industrie – jetzt und in Zukunft!
- Auch wenn dieses zufällige Konstrukt auf der Landkarte namens deutschland bereits 2023 keine laufenden Atomkraftwerke mehr besitzt, so ist es doch im Business noch gut dabei: mit der Brennelementfertigung in Lingen beliefert Framatome ANF den internationale Markt, die Wiederaufbereitungsanlage für Atombrennstoffe in Gronau bedient ebenfalls nach wie vor die internationalen Märkte und in der Suche nach einem Endlager haben wir nach wie vor keine Lösung, regelmäßig verschiebt sich nur das angestrebte Zeitziel, zu dem wir eine Lösung haben wollen.
Wie ist nun die aktuelle Situation?
- Die Urananreicherungsanlage in Gronau (ca. 70 km Luftlinie von Osnabrück) läuft mit unbefristeter Betriebsgenehmigung weiter und produziert Uran für den Weltmarkt.
- Die Brennelementfabrik in Lingen (ca. 60 km Luftlinie von Osnabrück) versorgt AKW in ganz Europa mit Brennstoff, kooperiert mit dem russischen Staat und läuft ebenfalls unbefristet.
- Zahlreiche Transporte hochradioaktiver Abfälle stehen in den nächsten Wochen und Monaten bevor. Die allermeisten davon nach Ahaus (ca. 75km Luftlinie von Osnabrück). Diese Castor-Transporte sind eine sinnlose Verschiebung hochgefährlichen Mülls, von dem keine*r weiß wohin.
Um etwas mehr ins Detail zu gehen:
Der Hersteller der Brennelemente in Lingen, Framatome ANF, beantragte beim Niedersächsischen Umweltministerium eine Genehmigung für die Kooperation mit Rosatom, dem russischen Atomanlagen-Hersteller. Ziel ist die Herstellung von Brennelementen, die auch in Atomkraftwerken russischer Bauart verwendet werden können. Framatome ANF musste nach intensiven Recherchen vor Ort zugeben, dass sich im Frühjahr diesen Jahres rund 20 Rosatom-Mitarbeiter*innen mehrere Wochen lang in Lingen aufhielten und dabei rund 20 Mitarbeiter*innen von Framatome schulten. Laut Framatome fand aber keinerlei Sicherheitsüberprüfung der Rosatom-Mitarbeiter statt. Und nur um das klar zu sagen: Rosatom arbeitet und verantwortet als Atombehörde den gesamten zivilen und militärischen Bereich der russischen Atomtechnologie und ist als Staatsunternehmen direkt der russischen Regierung unterstellt – von einer Kooperation profitiert also eine Regierung, die aktuell einen Angriffskrieg führt und gegen die umfangreiche Sanktionierungen den Import und Export einer Vielzahl von Gütern – sehr zurecht – verhindert. Produkte der Atomindustrie gehören offensichtlich nicht dazu …
Vor Ort regt sich Protest dagegen – so gab es einen Erörterungstermin, bei welchem über die geplante Kooperation informiert werden konnte – und bei dem Einwende gegen diese Kooperation, gegen das Joint Venture eingebracht werden konnten. Das geschah auch: 11.000! Einwendungen wurden eingereicht – und dass ist eine Zahl, die sich vor Augen geführt werden muss: zu einem Thema, das keine hohe Sichtbarkeit mehr in der medialen Aufmerksamkeit mehr erhält und in dem Vertuschung und Verschweigen an der Tagesordnung sind, wurden 11.000! Proteste gegen die Kooperation eingereicht. Bettina Ackermann von der Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt sagte dazu:
Der Betreiber der Lingener Atomfabrik, Framatome ANF, hat bei der Erörterung eingeräumt, dass er nicht nur sämtliche für die Fertigung der sechseckigen Brennelemente nötigen nicht-nuklearen Komponenten von Rosatom beziehen wird. Rosatom wird Framatome ANF zufolge sogar fertig verschweißte und befüllte Brennstäbe zuliefern, die in Lingen dann nur noch montiert werden. Eine Manipulation der Brennstäbe wäre damit problemlos möglich.
Was will ich mit dieser ausführlichen Schilderung darstellen? Es gibt und gab seit langem einen breiten Widerstand gegen Atomenergie – mit vielfältigen Protestformen, einer absoluten Notwendigkeit der Gegenwehr und mit sehr viel Erfolg! Und wenn dieser Protest darauf zielt, eine eklatante Gefahr für Umwelt und Gesellschaft – und das ist Atomenergie ganz fraglos – abzuwenden, dann ist das kein Thema ‚eigener Auffassung‘, sondern ein ganz essentieller Teil selbstorganisierten Handelns und Verantwortung-Übernehmens. Diesen Protest gegen ein Treiben, das sowohl die Umwelt zerstören als auch die Bevölkerung massiv gefährden kann, als eine ‚Überzeugung des Handelnden von der Überlegenheit seiner eigenen Ansicht‘ negiert aufs krasseste die Rolle der Gesellschaft und degradiert sie zu willfährigen Objekten – und offenbart ein beeindruckend ignorantes Bild von Gesellschaft.